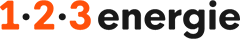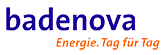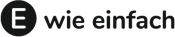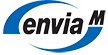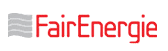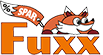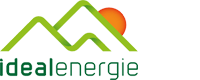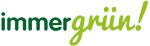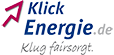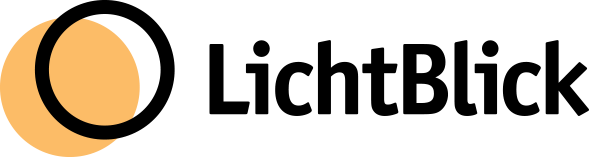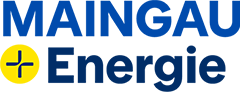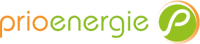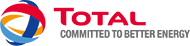Anders als Solarenergie und Windkraft ist Geothermie grundlastfähig und besitzt somit das Potenzial, rund um die Uhr Energie bereitzustellen. Geothermie-Technologien nutzen Wärmeenergie aus unterirdischen Wärmequellen und können damit Strom erzeugen, Gebäude heizen sowie Energie speichern.Der Ausbau dieser Technologie gewinnt derzeit sowohl in Deutschland als auch international an Bedeutung. Doch warum gilt Geothermie als besonders zukunftsfähig? Welche Chancen bieten sich im Rahmen der Energiewende? Und wie steht Deutschland im internationalen Vergleich?
Was bedeutet „Geothermie“?
Der Begriff “Geothermie” stammt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich übersetzt “warme Erde” oder “heißes Land”. Gemeint ist die im Erdinneren gespeicherte Wärmeenergie, die oft auch als „Erdwärme“ bezeichnet wird.
In der Praxis versteht man darunter meist die in der Erdkruste, im Gestein oder in Grund- und Tiefenwässern vorhandenen hohen Temperaturen und deren technische Nutzung. Diese Erdwärme ist auf die Resthitze der Erdentstehung und natürliche Zerfallsprozesse zurückzuführen und steigt mit zunehmender Tiefe kontinuierlich an. Zusätzlich wird die Temperatur in den oberen Metern der Erdkruste (10 bis 15 Meter) durch das aktuelle Klima und Wetter, wie beispielsweise die Sonneneinstrahlung, jahreszeitabhängige Temperatur, versickerndes Regenwasser sowie Wärmeaustausch, beeinflusst.

Wie funktioniert die Nutzung von Erdwärme?
Geothermieanlagen können in zwei Grundarten kategorisiert werden. Zum einen gibt es die oberflächennahe Geothermie und zum anderen die tiefe Geothermie. Innerhalb dieser Kategorien existieren verschiedene technische Varianten, welche verschiedenen Prozessen folgen, oder auch Hybridanlagen, in denen Geothermie mit Solarthermie oder Biomasse kombiniert wird.
Was sind oberflächennahe Geothermieanlagen?
Die oberflächennahe Geothermie nutzt Erdsonden, Erdwärmekollektoren oder Rohrsysteme, welche in ca. 50 bis 400 m Tiefe eingebracht werden. In diesen Schichten herrschen relativ konstante Temperaturen von ca. 8 bis 12 Grad Celsius.
Es kommen meist geschlossene Rohrsysteme zum Einsatz, die in Bohrlöcher verlegt werden. In den Rohren zirkuliert dann eine Wärmeträgerflüssigkeit, welche die im Boden gespeicherte Energie aufnimmt. Diese Wärme wird dann mit Hilfe eines Wärmetauschers an eine Wärmepumpe übertragen, welche das Temperaturniveau eines Kältemittels auf Heizungsniveau anhebt. Kältemittel funktioniert wie in dem Fall nicht nur zum Kühlen, sondern können durchs Verdampfen und anschließendes Verdichten auch Wärme aufnehmen und auf ein höheres Temperaturniveau bringen.
Bei dieser Art steht die Erschließung von Wärmeenergie, welche zur Heizung von Gebäuden oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann, im Vordergrund. Im Sommer kann der Prozess umgekehrt werden, sodass die Systeme auch zur Kühlung dienen können. Alternativ gibt es auch die Funktion als Wärmespeicher, wobei die oberflächennahe Erdwärme als Erdspeicher genutzt wird. Diese Systeme sind auch bekannt als BTES (Borehole Thermal Energy Storage) oder ATES (Aquifer Thermal Energy Storage).
Was sind tiefe Geothermieanlagen?
Bei der tiefen Geothermie finden Bohrungen statt, welche mehrere hundert oder sogar tausend Meter tief reichen können. Dafür gibt es verschiedene Systeme, die jeweils unterschiedlich funktionieren.
Eine typische Art der tiefen Geothermie sind sogenannte “Petrothermale Systeme”, welche die thermische Energie heißer Gesteine nutzen. Dabei wird Wasser in das untergründige, heiße Gestein gepresst, wodurch bereits vorhandene, kleine Spalten und Risse in den Gesteinsmassen mit hydraulischem Druck erweitert werden. Dieser Vorgang ermöglicht nun einen unterirdischen Wärmeaustausch. Als Folge kann das Wasser Temperaturen von bis zu 200 Grad Celsius erreichen, abhängig von Tiefe und regionalen Gegebenheiten. Nach der Beförderung zur Erdoberfläche kann die Energie zur flächendeckenden Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden.
Zusätzlich gibt es beispielsweise auch noch “Hydrothermale Systeme”, welche Heißwasser oder Dampf-Reservoire nutzen.

Wo steht Deutschland bei der Nutzung von Geothermie?
Die Nutzung von Erdwärme kann einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Strom- und Wärmeerzeugung der Zukunft leisten. Besonders im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien punktet Geothermie durch ihren geringen Flächenbedarf und ihre hohe Verfügbarkeit. Aktuell sind in Deutschland zahlreiche oberflächennahe Anlagen in Betrieb, während die tiefen Anlagen noch weniger ausgebaut sind. Mehr dazu in “Wie sind die aktuellen Zahlen?”. Gerade diese tiefen Anlagen sind jedoch entscheidend für eine flächendeckende Strom- und Wärmeversorgung und werden dementsprechend zunehmend, durch beispielsweise politische Anstrengungen und neue Projekte, gefördert.
Wie ist die politische Lage?
Die aktuelle deutsche Politik setzt verstärkt auf den Ausbau von Geothermieanlagen zur Stromerzeugung und Wärmeversorgung. Zentrale Ziele sind die Erfüllung der Vorgaben der Energiewende und die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und Energieimporten.
Ein bedeutender Schritt war der Beschluss des Geothermie-Beschleunigungsgesetzes im August 2025. Damit setzte die Bundesregierung einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag um und überführte gleichzeitig die europäischen Vorgaben der Erneuerbaren Energien Richtlinien in das nationale Recht. Mit diesem Gesetz soll der Ausbau von benötigter Infrastruktur, Geothermieanlagen, sowie Wärmepumpen, -speicher und -leitungen erleichtert und beschleunigt werden. Dazu gehören beispielsweise vereinfachte Genehmigungsverfahren sowie die ganzjährige Nutzung von Messfahrzeugen zur Erkundung des Untergrundes.
Das neue Gesetz trifft überwiegend auf große Zustimmung und gilt als Meilenstein der Geothermieentwicklung. Kritisiert wird jedoch, dass die Maßnahmen nicht umfassend genug sind. Nach Ansicht des Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. ist das Gesetz nicht weitreichend genug. Dies bezieht sich beispielsweise auf den gesamten Prozess der Erdwärmegewinnung und alle technischen Varianten der Quellenerschließung von Wärmepumpen. Trotz dieser Einwände trifft das Gesetz insgesamt auf positive Reaktionen und Unterstützung.
Wie sind die aktuellen Zahlen?
In Deutschland gibt es aktuell rund 480.000 oberflächennahe Geothermiesysteme und 42 tiefe Geothermieanlagen (Stand Mai 2025). Der Schwerpunkt in Deutschland liegt damit klar auf der Wärmegewinnung durch oberflächennahe Systeme. Für eine flächendeckende Energieversorgung sind jedoch vor allem die 42 Tiefenanlagen von Bedeutung. Von diesen 42 bestehenden Kraftwerken dienen 31 Kraftwerke ausschließlich der Wärmebereitstellung, 9 kombinieren Wärme und Stromerzeugung und 2 erzeugen ausschließlich Strom. Zusätzlich sind in Deutschland 8 Forschungsanlagen in Betrieb.
Aktuelle Anstrengungen und Ausbauprojekte führen dazu, dass derzeit 16 Anlagen neu gebaut werden und weitere 158 Anlagen in Planung sind.
Wie sind die Gegebenheiten für Geothermie in Deutschland?
Das Potenzial für die Technologie und den Ausbau hängt stark von der geologischen Beschaffenheit ab. Besonders gut geeignet ist Süddeutschland, vor allem das Molassebecken in Bayern und das Alpenvorland. Hier kann bereits eine Agglomeration von Projekten beobachtet werden und es gilt als das Zentrum der tiefen Geothermie in Deutschland. Zusätzlich gilt der Oberrheingraben, entlang der Grenze zu Frankreich, als weitere wichtige Region. Diese zeichnet sich vor allem durch eine gute Erreichbarkeit von heißem Wasser in geringer Tiefe aus. Langfristig kann auch Norddeutschland in den Fokus rücken. Das dort liegende große Sedimentbecken bietet grundsätzlich viel Potenzial, doch die Erschließung und damit einhergehende Bohrungen gelten als kostspielig, schwerer erschließbar und verbunden mit aufwendiger technischer Planung.
Wie stark wird Geothermie international genutzt?
Im internationalen Vergleich gelten Länder wie die USA, Indonesien, die Philippinen, die Türkei und Island als Spitzenreiter. Die USA ist weltweit führend und besitzt in Kalifornien eines der größten Geothermiekraftwerke der Welt. Indonesien bietet sehr gute geologische Gegebenheiten durch großes Potenzial mit vielen aktiven Vulkanen und gilt als zweitgrößter Geothermie-Stromproduzent weltweit. Die Philippinen haben Vorteile durch die geologische Lage im sogenannten "Pazifischen Feuerring”. Die Türkei fördert Geothermie-Stromerzeugung vor allem im Westen des Landes und zeichnet sich durch einen sehr dynamisch wachsenden Strommarkt aus.
Darüber hinaus gilt auf dem europäischen Kontinent Island als Vorreiter und ist gleichzeitig die Weltspitze in der Nutzung von Strom aus Geothermieanlagen auf die Einwohnerzahl gerechnet. Weitere europäische Länder zeigen Bemühungen bei der Förderung und Entwicklung, dazu zählen beispielsweise Frankreich, Italien, Ungarn und eben Deutschland.

Welche Chancen und Vorteile bietet Geothermie?
Geothermie verspricht ein großes Potential, um die zukünftige Strom- und Wärmeerzeugung entscheidend zu verändern. Zu den zentralen Vorteilen zählen Stichworte wie: kostengünstig, unerschöpflich und Entwicklungspotenzial.
Kostenvorteile ergeben sich insbesondere im Betrieb: Geothermieanlagen sind langlebig und haben niedrige laufende Kosten. Allerdings muss dabei beachtet werden, dass zur Zeit hohe Kosten für Forschung, Bau und Technologieverbesserung nötig sind. Somit sind jetzt Investitionsbeträge nötig, um auf lange Sicht kostengünstig nutzbare Energie zu gewinnen.
Die Technologie und Anlagen der Geothermie gelten als unerschöpfliche Energiequelle, da diese nicht nur ganzjährig zuverlässig sind, sondern auch eine Grundlastfähigkeit und Unabhängigkeit bieten.
Dabei geht es nicht nur um Unabhängigkeit von Wetterbedingungen (vor allem relevant, wenn man Solar- oder Windenergie betrachtet), sondern auch von anderen Ländern und fossilen Brennstoffen. Hand in Hand mit der Unabhängigkeit wird die Geothermie als entscheidendes Element der zukünftigen Energieversorgungssicherheit gesehen.
Die aktuelle Relevanz und Deutschlands aktuelle Projekte zum Ausbau zeigen, dass es sich um eine noch relativ junge Technologie handelt. Viele sehen noch enorme Möglichkeiten für weitere technische Fortschritte und Entwicklungen, um die Technologie nicht nur noch nachhaltiger, sondern auch noch effizienter und ertragssteigernder zu gestalten.
Was sind Probleme und Herausforderungen von Geothermie?
Trotz ihres großen Potenzials steht die Geothermie in Deutschland vor mehreren Herausforderungen. Als Hauptkritikpunkt stellen die hohen Investitionskosten eine finanzielle Herausforderung dar. Diese Investitionen können beispielsweise im Bereich des Ausbaus für nötige Infrastruktur, Forschungskosten oder Bodenuntersuchung liegen. Diese Ersatzinvestitionen erschweren den Ausbau, obwohl die Betriebskosten langfristig niedrig sind.
Hinzu kommen technische Risiken: Unzureichende Untersuchungen können besonders bei tiefen Bohrungen zu induzierten Erdbeben oder Bergschäden führen. Um solche Gefahren zu minimieren, muss die generelle Forschung vorangetrieben, präzise Untersuchungen gefördert und finanzielle Unterstützung geschaffen werden. Diese Maßnahmen sind nötig, um Sicherheit für die Bevölkerung und die Umwelt zu garantieren.
Auf politischer Ebene wird eine unzureichende Unterstützung der Regierung kritisiert. Beispielsweise wird bemängelt, dass bundesweite, klare Geothermie-Strategien fehlen.
Diese Herausforderungen und Unsicherheiten bremsen die Förderung von Geothermie und zeigen trotz des großen Potenzials für die Energiewende gerechtfertigte Kritik auf.
Welche Rolle spielt Geothermie in Zukunft?
Deutschland verfügt, insbesondere in Süddeutschland und im Oberrheingraben, über ein solides Potenzial für die Nutzung von Geothermie-Technologien. Die aktuellen Entwicklungen und Diskussionen zeigen, dass die Technologie zunehmend an Bedeutung und Relevanz gewinnt. Im internationalen Vergleich wird deutlich, dass Deutschland noch zurückliegt und die Nutzung von Erdwärme noch keine feste Säule der Energiewende darstellt.
Für die Zukunftsperspektive werden Forschungsprojekte, Investitionen und politische Rahmenbedingungen entscheidend sein, um die bestehenden wirtschaftlichen, technischen und bürokratischen Hürden zu überwinden. Besonders im Wärmesektor kann Geothermie eine Schlüsselrolle einnehmen, da sie grundlastfähig, klimafreundlich und langfristig unabhängig von fossilen Energieträgern ist.
Mit gezielten Förderprogrammen und konsequenter Weiterentwicklung könnte Geothermie somit einen wichtigen Beitrag leisten, damit Deutschland seine Klimaziele 2045 erreicht und die Energieversorgung langfristig sicherstellt.